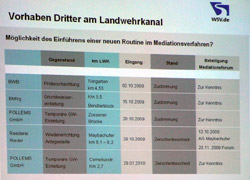BürgerInnen-Inititative Bäume für Kreuzberg
Bericht von einem halböffentlichen Arbeitstreffen
Letzten Mittwoch (16.2.) lud das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg „interessierte Bürgerinnen und Bürger“ via Web und Mail-Verteiler zum „1. Arbeitstreffen Ideenwerkstatt Görlitzer Park“, das der „Vertiefung/Ergänzung der bereits beim letzten Treffen am 27.11.09 geäußerten Ideen“ dienen sollte, in die Görlitzer Straße 3. Dass es sich bei Haus 3 („Kreuzer“) um eins der ehemaligen backsteinernen Bahngebäude auf dem Parkgelände selbst handelt, war indes nicht allen Interessierten klar. Hinweisschilder gab es keine, so dass manche, nachdem sie den „Kreuzer“ doch noch gefunden hatten, unschlüssig vor seiner bunkermäßigen Stahltür verharrten und, nachdem sie sich bemerkbar gemacht hatten, von Herauskommenden gefragt wurden, ob sie denn auch eingeladen seien. − Der Eindruck einer geschlossenen Gesellschaft musste sich aufdrängen.
Was heißt Öffentlichkeit?
Die Frage nach dem Wesen von Öffentlichkeit wurde aufgeworfen, und Baustadträtin Kalepky erklärte in gewohnt vieldeutiger Weise, dass man einerseits selbstverständlich alle Interessierte ansprechen wolle, aber andererseits so eine Ideenwerkstatt ja auch arbeitsfähig halten müsse. − Immerhin wurden die Personen ohne Einladung nicht abgewiesen, so dass neben den VertreterInnen von Verwaltung und BVV-Fraktionen immerhin auch ein Dutzend einfache BürgerInnen, bevor sie weitere Ideen zur Parkgestaltung und -nutzung äußerten, zunächst eine Weile den Ausführungen des versierten Moderators Jens Hubald lauschte, womit er die bereits gesammelten und auf Plakaten präsentierten Früchte des „Auftakttreffen“ vom November erläuterte. − Anschließend wurden weitere Ideen gesammelt, bevor sich dann die Anwesenden in Kleingruppen aufteilten, um die verschiedenen Themenschwerpunkte zu vertiefen, wobei auffiel, dass sich in jede der Gruppen mindestens ein(e) Amtsperson bzw. MandatsträgerIn mischte. − Wenigstens wurde im Plenum gefordert, dass auch künftig noch Neulinge teilnehmen und Ideen einbringen können sollten.
Noch eine Vorbemerkung
Auf der BA-Website findet sich sogar das Protokoll der 1. Ideenwerkstatt, während wir auf jenes der dem Auftakt vorangegangenen allerersten „Bürgerversammlung“ im Frühling letzten Jahres wohl vergeblich warten werden. Wie wir jetzt erfahren haben, sollte es da eigentlich nur um den unsäglichen Pamukkale-Brunnen gehen. Ganze zwei Bürger sollen sich damals unter den MitarbeiterInnen aus Verwaltung und Politik befunden haben und höchst überrascht gewesen sein, als gegen Ende des Treffens die Baustadträtin unversehens Pläne zur Umgestaltung von Lohmühleninsel und Ostteil des Görlitzer Parks hervorzog. Die verwunderten Fragen nach der Finanzierung habe sie mit einem triumphierenden Verweis aufs aus Landes-, Bundes- und EU-Mitteln gespeiste Programm „Stadtumbau West“ beschieden. Eine Bürgerbeteiligung habe es also definitiv nicht gegeben − wie denn auch mit zwei Bürgern? Übrigens wird im vorhandenen Protokoll der späteren Auftaktveranstaltung die Kritik an den vollendeten Tatsachen im Ostteil durchaus vermerkt.
Nur Beteiligung von Anbeginn macht Sinn!
Und wir können an dieser Stelle nur wieder darauf verweisen, dass jedenfalls Bürgermeister Schulz höchstselbst zur Zeit jener ersten geheimnisumwitterten Zusammenkunft noch jedwede Umbaupläne des Görlitzer Parks als „Quatsch“ qualifizierte und abtat. − Dass seine Baustadträtin im Hinblick auf die ja ebenfalls mit massiven Fällungen und Rodungen einhergegangene Umgestaltung der Lohmühleninsel − und seitens vieler NutzerInnen, die sich seitdem von dort fernhalten, ebenfalls überaus kritisch beurteilt −, nun von einer Beteiligung der AnwohnerInnen auch bei diesem Vorhaben spricht, wo es doch dort gar keine gibt, wirft nur ein weiteres Licht auf ein sehr kontraproduktives Verständnis von BürgerInnen-Beteiligung, jedenfalls wenn sie echt und nicht nur symbolisch, also Feigenblatt sein soll.
Das verschwundene Protokoll
Auf unsere erneute (es war mittlerweile wohl die dritte oder vierte) Anmahnung des erwähnten Protokolls, dessen Übersendung uns ja immerhin im Anschluss an eine offizielle BürgerInnenanfrage in der BVV im Dezember zugesagt worden ist [im Sitzungsprotokoll eigens vermerkt!], wurden wir diesmal nicht mit der Auskunft, die Zusendung sei „angeschoben“, sondern auf die Umweltausschusssitzung am 16.3. vertröstet. Zwei BürgerInnen hatten damals nach der Handhabung der Partizipation von AnwohnerInnen und NutzerInnen gefragt, als im konkreten Fall der Durchbruch gleich zweier Toreinfahrten in die östliche Görli-Mauer entschieden wurde sowie die Verbreiterung und Pflasterung der Wege und der zum Hauptweg führenden Treppe, was mit der Rodung zahlreicher Bäume und Büsche im ökologisch wertvollsten Teil des Parks [Berichte siehe hier und hier] einherging, ausgerechnet jenes Bereichs, der seinerzeit als von den stärker frequentierten Bereichen abgegrenztes Feuchtbiotop geplant war, welche Planung die Baustadträtin auf jener BVV jedoch allen Ernstes als nach der Vereinigung nicht mehr zeitgemäß und dem Zusammenwachsen von Treptow und Kreuzberg als nicht förderlich bezeichnet hatte.
Erst Tatsachen, dann das Konzept
Die umfassende Darstellung des − auch ohne Wissen der BzV und des Bürgermeisters und vor der Auftaktveranstaltung zur Bürgerbeteiligung großenteils längst umgesetzten – Konzepts war indessen schon für die UMV-Sitzung am vergangenen Dienstag (16.2.) avisiert und bis dahin ein Fäll- und Baustopp zugesagt, auf der Tagesordnung dieser Sitzung aber offenbar kein Platz mehr, deshalb die erneute Vertagung. Wir können nur hoffen, dass der Baustopp auch dann noch gilt, wenn nun Tauwetter einsetzt, denn − um endlich zum Arbeitstreffen zurückzukehren: die TeilnehmerInnen der Gruppe zum Schwerpunktthema „Ökologie und Naturschutz“, die sich innerhalb des Arbeitstreffens zusammenfand, machten u.a. deutlich, dass sie keine weitere „Erschließung“ durch kehrmaschinenbreite, versiegelte Wege wünschen, gerade im Bereich hinter dem Binsen- und Schilfbestand des kleinen Teichs, der für Wasservögel wenn schon keine Brut-, so doch eine Rückzugsmöglichkeit schafft, zumal angesichts der Hundebadestelle auf der gegenüberliegenden Seite. Vor allem er ist von der sonst allgegenwärtigen Übernutzung zu bewahren! (Und ausgerechnet unsere Baustadträtin konnte sich nicht enthalten, abermals mit der Geschichte der Rote-Listen-Ralle aufzuwarten, die dort angeblich ihr Brutgeschäft betreibe und deren Einflugsschneise baumfrei gehalten werden müsse…)
Konzeptarbeit
Die Schwerpunktthemen

Görli-Modell © In Transition SO36
Im Rahmen dieses Schwerpunkts zu Ökologie und Naturschutz ist auch die Intitiative In Transition SO36 in Zusammenarbeit mit dem Türkisch-deutschen Umweltzentrum (TDZ) schon weit damit gediehen, ein Konzept zu entwickeln, um „den Park nicht nur als Freizeit- und Spielstätte zu begreifen, sondern auch seine besondere Eignung als naturnaher Erlebnisraum zu sehen, in dem sich mitwelt- und umweltsensibles Verhalten lernen lässt“. Vertreterinnen machten Vorschläge zur Anlage eines Naturspielplatzes, eines Naturlehrpfads, einer hundefreien Zone, einer dezidiert fahrradunfreundlichen bzw. nicht zum Rasen einladenden Wegeplanung und einiges mehr. Sie hatten überdies auf einem Plan des Geländes aus Pappe ein großes dreidimensionales Modell mit den umgebenden Gebäuden etc. gebastelt, worin sich dann mit beschrifteten Kärtchen die verschiedenen Vorschläge und Ideen wunderbar markieren und situieren ließen.
Interkultureller Garten – urbane Landwirtschaft

Interkultureller Garten
Weiterhin ging es unterm Label „Ökologie und Naturschutz“ − vielleicht doch nicht so geschickt und auch mehr aus Platz-, denn inhaltlichen Gründen − noch um den interkulturellen Garten und den Ausbau des bereits bestehenden Projekts auf ggf. weiteren Flächen. Die ökologische Wertigkeit naturnahen Gärtners und von Kleingärten im urbanen Raum überhaupt ist natürlich unbestritten. Der Erhalt alter Kulturpflanzen, etwa Obstsorten, und die Bedeutung klimafreundlicher Ernährung und umweltfreundlicher Konservierungstechniken wurden angesprochen. Vor allem sind der sozial integrative Aspekt sowie das Wecken von Verantwortlichkeits- und Identifikationsgefühlen im Hinblick aufs selber Bearbeitete und Gepflegte und damit die dringend notwendige Eindämmung von Vermüllung und Vandalismus sowie nicht zuletzt die umweltpädagogische Komponente kaum zu überschätzen. Hier wurde auch die Anlage eines Lehrgartens angeregt und ferner betont, dass der interkulturelle Garten nicht etwa umzäunt sei, sondern der Allgemeinheit offen stehen solle.
Doch Zielkonflikte zwischen anthropogener Auslese und Kultivierung einerseits, dem Zulassen eigendynamischer Entwicklungen und Diversifizierung andererseits liegen wohl auf der Hand. Ob ein Lehrpfad mit Schilderwald im Görli Sinn macht, wo er sich in der Fläche ja nur auf die Kennzeichnung der Baumarten beschränken könne, während er in ökologisch wertvolleren Bereichen dem Versuch, diese gerade von hoher BesucherInnen-Frequenz zu schützen, zuwiderlaufe, scheint ebenso zweifelhaft, wie die Durchsetzbarkeit eines Leinenzwangs für Hunde in definierten Bereichen. Es ist natürlich nicht richtig, dass die Zweckentfremdung des Teichs als Hundebadestelle unproblematisch sei, wenn denn Wasservögeln in den Schilfbereichen Brutmöglichkeiten geboten werden sollen, aber hier ist eine Lösung z. B. mittels ordnungsamtlichem Instrumentarium weder wünschenswert noch möglich.
Auch der Görli verdient ein ökologisches Parkpflegekonzept!

Ökologie + Naturschutz
Die Kartierung schützens- und erhaltenswerter Biotope im Park wurde vorgeschlagen, der so naturfern gar nicht sei, sondern nur übernutzt. Geeignete Stellen sollten aufgewertet und auch eine Kompensation für die angerichteten Schäden im Ostteil nicht vergessen werden. Sodann bedürfe die Grünflächenpflege auch hier dringend eines Paradigmenwechsels hin zu größerer Naturnähe, worin doch sogar Sparpotentiale liegen: Nur zweimal jährlich zu mähende Wildblumenwiesen sollten angelegt und versteckt liegende Bereiche, abgesehen von ihrer Entmüllung, in Ruhe gelassen werden. Laub sei keinesfalls mit den berüchtigten Laubbläser oder gar -sauger emissions-, zeit- und kostenintensiv so biologisch wie klimaschädlich dem natürlichen Stoffkreislauf zu entziehen, sondern auf jeden Fall unter Büschen und Bäumen zur Humusbildung, als Erosionsschutz und Habitat für eine Vielfalt von Kleinlebewesen, die wiederum Nahrungsquelle von Vögeln sind, liegen bleiben. Die Sträucher sollten selten und dann behutsam, fach- und artgerecht beschnitten werden. − Eine ausreichende Wässerung der Bäume und Grünflächen ist vonnöten, die mittels des vorhandenen Tiefbrunnens nach den Worten des anwesenden Fachbereichsleiters Schädel ja auch finanziell erschwinglich sei, aber nach den Beobachtungen direkter AnwohnerInnen merkwürdigerweise oft in der Mittagshitze erfolge oder wenn es gerade geregnet habe, in Trockenphasen aber so lange unterbleibe, bis der Rasen verdorrt und Neupflanzungen geschädigt seien.
Kinderbauernhof
Zum Komplex Umweltbildung und Naturerfahrung gehört auch die gewünschte Stärkung des Kinderbauernhofs, der sich außerdem für die gewünschten gemeinsamen Aktionen mit Schulen anbiete. − Wohlwollen fand der Vorschlag, Kremserfahrten mit dem Eselskarren zu veranstalten und/oder auf diesem Weg zugleich Müll einzusammeln. Für die in diesem Zusammenhang geäußerten versicherungstechnischen Bedenken: wenn etwa der Esel jemanden beiße oder der Karren über Füße fahre, dürften sich selbst hierzulande ausräumen lassen.
Sauberkeit
Beim Stichwort Sauberkeit ging es um die Aufstellung verschließbarer, krähensicherer Mülltonnen, ihre zeitnahe Leerung, die Durchführung eines dritten Reinigungsgangs, einen strikt abgegrenzten Grillplatz etc. − Eine interessante Idee ist auch, geeigneten Müll (Büchsen, Styropor) mit dem Schaffen von Skulpturen künstlerisch zu recyceln.
Sicherheit
Selbstredend war ein Themenschwerpunkt die Sicherheit, in welchem Zusammenhang sofort vom „Dealerunwesen“ und dem Wunsch nach einer dealerfreien Zone die Rede ist. Dies solle nicht als „Law and Order“-Denken missverstanden werden − vermehrte Razzien werden abgelehnt−, dafür häufigere Polizeistreifen nach dem Modell des Weinbergparks oder gar der Hasenheide befürwortet. − Erfreulicherweise wurde hiergegen zu bedenken gegeben, dass die ortsüblichen Dealer weicher Drogen einer entrechteten und kriminalisierten Randgruppe angehören, nämlich Flüchtlinge und illegalisierte Einwanderer sind, die kaum andere Rückzugsräume und gar keine legalen Erwerbsmöglichkeiten haben, und dass neben ihren staatlich aufgezwungenen unwürdigen Lebensumständen vorwiegend ihr damit in Zusammenhang zu sehender Alkoholkonsum sie zuweilen aggressiv werden lasse. − Die These, dass jedenfalls auch diese Gruppe ein Aufenthaltsrecht im Görli genieße, wurde sehr kontrovers debattiert.
Unterm Sicherheitsaspekt war auch von der Notwendigkeit einer nächtlichen Beleuchtung die Rede, eines Winterdienstes und einer Befestigung der Wege, um die Bildung von Pfützen zu vermeiden (wobei die Sanierung aber nur schrittweise und nicht überall gleichzeitig erfolgen solle, zugleich aber auch bedacht zu werden verdient, dass wegen der ubiquitären Wegeversiegelungen z. B. Mehlschwalben kaum Nistmaterial mehr finden, welches nun mal aus feuchtem Lehm bestehen muss).
Sport
Ob und in welcher Form der offiziell nicht öffentliche große Fußballkäfig, der den Park regelrecht zweiteile, ausreichend genutzt werde (auch unterm Gender-Aspekt), sollte mal überprüft und dokumentiert werden. – An Stelle des viel zu breiten Wegs am Pamukkale-Brunnen wären zwei Boule-Plätze denkbar.
Surrealer Pamukkale-Brunnen
Ob dieser Brunnen, der ja inzwischen gar keiner mehr ist, überhaupt noch so heißen sollte, wurde in Frage gestellt. Das nunmehr entstandene Amphitheater könnte für Events genutzt, Sand und Liegestühle könnten aufgeschüttet bzw. -gestellt werden, wodurch freilich die ohnehin seltsame Idee, die gefährlich hohen Stufen durchs Aufstellen von Blumenkästen zum Verschwinden zu bringen, nicht zu realisieren wäre.
BürgerInnen-Beteiligung

Beteiligungsverfahren
Auch zum Thema Bürgerbeteiligung fand sich eine Gruppe zusammen, zu der sich auch die Baustadträtin gesellte. Einige TeilnehmerInnen bestritten zwar rundheraus, dass es überhaupt eine schlechte Bekanntgabe der Veranstaltung(en) und Informationspolitik gegeben habe. Der Einsatz des Internets wurde einhellig gelobt, doch den Vorschlag, ihn etwa durch ein Forum zweikanalig-dialogisch, also interaktiv zu machen, übersteigt nach Aussage Frau Kalepkys die derzeitigen Möglichkeiten im Amt. Mehr als die „Verlinkung“ von Einladungen und Protokollen sei nicht zu leisten.
Viel triftiger als der ständige Verweis auf die Benachteiligung der Offliner ist der Hinweis, dass gerade die virtuelle Beteiligungsmöglichkeit die Chancenungleichheit bei dieser wichtigen zivilgesellschaftlichen Betätigung mindert, insofern Menschen aus den verschiedensten Gründen an solchen Veranstaltungen real nun mal nicht teilnehmen können. − In diesem Zusammenhang frappiert auch die Unverfrorenheit, mit der einerseits versucht wird, die breite Öffentlichkeit außen vor zu halten, jedoch bei Sichtweisen, die der des Amts entgegen stehen, die sie Vertretenden darauf zu verweisen, dass sie nicht für „die“ BürgerInnen zu sprechen legitimiert seien. Engagierte Beteiligung, vernünftige Argumentation und Mitarbeit legitimiert!
Einen lebhafteren, besseren Austausch gelte es zu organisieren − verschiedne Mail-Verteiler wurden zusammengestellt −, und ansonsten, neben amtlichen Infos auf der Website oder via Pressemitteilung, auf Multiplikatoren wie Schulen, Kitas, Jugendeinrichtungen, Familienzentren, Migrantenvereine, Seniorenwohnheime und schließlich das QM gesetzt. Durch Plakatieren sollten Veranstaltungen ebenfalls beworben werden, und außerdem die Veranstaltungen wie das virtuelle Forum zum Bürgerhaushalt [die nächste Veranstaltung am 23.2. von 18:30 bis 20:30 Uhr im CABUWAZI und am 25.2. von 18:00 bis 20:00 Uhr im Kinderbauernhof, Wiener Str. 59b] aber auch das geplante Familienfest im Frühsommer auf der „Platte“ zu Information und Austausch, zur Einladung, sich zu beteiligen wie zum Knüpfen von Netzen genutzt werden.
Wie weiter?
Noch vor Ostern will man noch mal zusammenkommen, um die Ideen weiter zu konkretisieren, wobei auch die Möglichkeit eines selbstorganisierten Treffens erwogen wurde. Im Übrigen, so ein pragmatischer Vorschlag, könne aber eine weitere Konkretisierung auch darin bestehen, dass man von den zahlreichen Ideen eine anpackt und sich an ihre Umsetzung macht.
Die Initiative In Transition SO 36, die in der Ratiborstraße 4 einen Versammlungsort angemietet hat, lud ein, zu ihren regelmäßigen Treffen zu kommen, die Baustadträtin hingegen zur nächsten öffentlichen Umweltausschusssitzung am 16. März um 18:30 Uhr, wo sie den Bezirksverordneten im Nachhinein (besser spät als nie!) das Konzept der „Neugestaltung der südlichen Lohmühleninsel“ und insbesondere der „besseren Anbindung des Görlitzer Parks“ [siehe auch hier] erläutern will. − Es sollte an dieser Stelle auch nicht unerwähnt bleiben, dass der von sieben Initiativen unterzeichnete Offene Brief an Verwaltung und alle BVV-Fraktionen F’hain-Kreuzbergs, der sich ja an der ohne BürgerInnenbeteiligung erfolgten Missgestaltung des östlichen Teils des Görlis entzündete, aber auch gegen die Marginalisierung der Partzipation und damit einhergehenden naturfernen Gestaltung des Gleisdreick-Parks protestiert, tatsächlich von keiner Seite einer Antwort für wert befunden worden ist. − Wir können leider nicht umhin, darin eine eklatante Missachtung zivilgesellschaftlichen Engagements zu sehen.
Siehe auch das inzwischen online gestellte offizielle Protokoll.